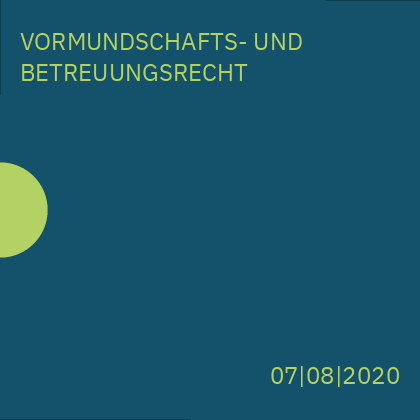Stellungnahme der DGKJP zum Referentenentwurf zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts vom 25.6.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir übersenden Ihnen heute eine Stellungnahme zur Reform des Vormundschaftsrechts.
Wir bitten höflich darum, künftig über Gesetzgebungsverfahren, die unser medizinisches Fachgebiet unmittelbar oder mittelbar betreffen, informiert zu werden. Wir vertreten als Wissenschaftliche Fachgesellschaft das Fachgebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie und sind bei der AWMF, beim Bundesgesundheitsministerium und beim Gemeinsamen Bundesausschuss diesbezüglich als stellungnahmeberechtigte Fachgesellschaft registriert.
Da die Zuständigkeit unseres Fachgebietes sich im Wesentlichen auf Minderjährige bezieht, nehmen wir ausschließlich zur Reform des Vormundschaftsrechts Stellung.
Allgemeines:
Dem Amtsrichterverband ist zuzustimmen, dass an der überkommenen Bezeichnung des Begriffs „Mündel“ noch gearbeitet werden könnte. Die qua Vormundschaft Betreuten als „Kind“ zu bezeichnen wäre zwar möglich, wir würden jedoch einen Begriff wie „Betreuungskind“ vorziehen, um zu betonen, dass es um ein Betreuungsverhältnis mindestens ebenso wie im Betreuungsrecht geht, mit zusätzlichem pädagogischen Anspruch. Insofern setzen wir in unserem nachfolgenden Text den Begriff „Mündel“ jeweils in eckige Klammern als [Mündel].
Zustimmend und positiv nehmen wir zur Kenntnis, dass die Partizipation des Kindes, das einen Vormund erhält, und die Zustimmung für Vorgänge ab dem 14. Lebensjahr festgeschrieben werden sollen, sowie dass die Kinder und Jugendlichen Antragsrechte erhalten und ihre Subjektstellung betont wird.
Ebenfalls ist für uns der Schritt besonders bedeutsam, dass ein persönlich benannter Vormund mit der Pflicht zu monatlichem persönlichem Kontakt (in unserer Ausdrucksweise ein „aktiv in Beziehung gehender Vormund“) und ein Recht des [Mündels] auf persönlichen Kontakt festgeschrieben wird, und dass möglichen Geschwisterrivalitäten mit der Möglichkeit, unterschiedlicher Vormünder für Geschwister zu bestellen, vorgebeugt wird.
Wir begrüßen die Stärkung der Rechte von Pflegekindern dahingehend, dass auch die Personen bei denen sie leben zu „Pflegern“ bestellt werden können, ebenso dass infolge möglicher Interessenkollusionen Einrichtungsleitungen hiervon ausgenommen sind.
Letztlich erscheint uns der veränderte Verfahrensweg der Bestellung eines Vormunds durch das Familiengericht sehr gut praktikabel, dass nicht einfach eine Überlassung der Bestimmung des Vormundes an das Jugendamt erfolgen darf, sondern das Jugendamt interimsweise für eine Zeit von 3 Monaten für die Suche nach einem geeigneten Vormund bestellt werden kann. Ebenfalls ist sehr zu begrüßen, dass auch die Jugendämter indirekt verpflichtet werden, einen Vormund nicht nach dem Buchstaben- oder Wohngebietsprinzip, sondern nach der persönlichen Eignung zu bestimmen.
Einen Nachbesserungsbedarf sehen wir in folgenden Punkten:
1. Auswahl des Vormunds und Vorüberlegungen
Zwar begrüßen wir explizit, dass nun vor der Bestellung eine Auskunft nach § 41 BZR für jeden Vormund eingeholt und regelmäßig alle 2 Jahre überprüft wird. Allerdings müsste diese auch für einen Pfleger für besondere Bereiche eingeholt werden, sofern dieser persönlichen Kontakt zum Kind hat – d.h. verzichtbar wäre auf eine erweiterte Bundeszentralregisterauskunft nur dann, wenn der Pfleger sich lediglich um die Anlage von Vermögen ohne Rücksprache mit dem Kind oder Jugendlichen zu kümmern hat. Insofern würden wir eine Ergänzung in § 168 begrüßen, da die Funktion des Pflegers explizit im neuen Vormundschaftsrecht für viele Bereiche denkbar ist, z.B. bei in Pflegefamilien lebenden oder in Einrichtungen betreuten Kindern. Gelegentlich entstehen Familienpflegeverhältnisse ohne Vermittlung des Jugendamtes und ohne diesbezügliche Vergütung, so dass hier das staatliche Wächteramt seitens des Familiengerichts ausgeübt werden müsste.
Zunächst als positiv bewerten wir, dass bei der Auswahl eines Vormunds (§ 1778) auch das religiöse Bekenntnis eines Kindes und der kulturelle Hintergrund und die Lebensumstände berücksichtigt werden sollen. Die Formulierung in der Begründung: „Bei Mündeln mit Migrationshintergrund soll bei der Auswahl des Vormunds nach Möglichkeit auch auf die im Zusammenhang mit dem kulturellen Hintergrund bestehenden Besonderheiten Rücksicht genommen werden“ (S. 237) erscheint jedoch aus unserer Sicht missverständlich. Zu den Qualitätsanforderungen für künftige Vormünder sollte nicht zählen, dass ein Vormund der identischen Religionszugehörigkeit oder des identischen kulturellen Hintergrundes bestimmt wird, sondern vielmehr eine Persönlichkeit, die bereit und in der Lage ist, sich mit Anforderungen von Interreligiosität oder Interkulturalität auseinanderzusetzen, d.h. sich auch bestmöglich für die Integration des betroffenen Kindes oder Jugendlichen unter Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes einsetzen kann. Hier wäre eine Abänderung des Begründungstextes wünschenswert.
Weiterhin halten wir den § 1779, der die Eignung des Vormunds beschreibt, für zu wenig konkret auf die individuellen Problemlagen hin gefasst. Das betrifft auch den Begründungstext. Beispielsweise wäre bei sehr jungen Kindern die Möglichkeit der persönlichen Kontinuität der Vormundschaft zu berücksichtigen, je nach psychischer Verfasstheit des [Mündels] auch die psychische Belastbarkeit des Vormunds. Bei behinderten Kindern wären Basiskenntnisse hinsichtlich Versorgung und Förderung zu fordern. Eine fachliche Nähe zu anderen das [Mündel] betreuenden Fachkräften und die Fähigkeit mit diesen auf Augenhöhe zu kommunizieren wäre wünschenswert. Ohne eine Konkretisierung dieser stark variierenden Qualifikationsanforderungen könnte es schwierig werden, genügend geeignete Vormünder zu gewinnen.
Vorschlag: im Gesetzestext, hilfsweise in der Begründung könnte ergänzt werden: „Kenntnisse und Erfahrungen je nach den individuellen Bedürfnissen und Problemlagen des [Mündels] wie Alter und biographischen Erfahrungen. Behinderung u.a.m.“
2. Alter des (ungeborenen) [Mündels]
Selbstverständlich sind im Einzelfall die Rechte ungeborener Kinder zu berücksichtigen. Eine Veränderung der Definition in z.B. § 1810 als „bereits gezeugtes Kind“ halten wir zwar gegenüber „Leibesfrucht“ für sinnvoll. Es wäre aber aus unserer Sicht besser, eine zeitliche Begrenzung einzuführen, da bereits ein Embryo nach in-vitro-Fertilisation als „bereits gezeugtes Kind“ gelten kann, oder ein Fötus, bei dem ein Schwangerschaftsabbruch noch möglich wäre. Nicht auszudenken wären etwa Auseinandersetzungen zweier Vormünder (etwa des Vormundes einer minderjährigen schwangeren Mutter mit dem Vormund des ungeborenen Kindes) dahingehend, ob das Ungeborene nun einem Schwangerschaftsabbruch zugeführt werden darf oder nicht, oder ob die Gesundheit der Mutter oder die des Ungeborenen Vorrang haben. Medizinisch ist darauf hinzuweisen, dass sich die Überlebensfähigkeit von Frühgeborenen in den letzten Jahren stark zu einem jüngeren Gestationsalter hinbewegt hat.
Vorschlag: Der Begriff „Fötus jenseits der 12. Schwangerschaftswoche“ würde den Begriff „bereits gezeugtes Kind“ besser beschreiben.
3. Fallbelastung der Vormünder
Nichts ausgesagt wird im Gesetz zur Fallbelastung, die ein Vormund noch schultern können soll. Wir halten eine gesetzliche Begrenzung der Belastung aus den im Eingangstext genannten Gründen für erforderlich. Ursprünglich sollte im SGB VIII eine Begrenzung auf 50 Fälle pro Vormund eingeführt werden. Wir halten bei den nunmehr gesteigerten Anforderungen an (Berufs- oder Vereins-) Vormünder eine Fallbelastung von 50 [Mündeln] für das maximal mögliche, besser wären nur 30 Fälle pro Vormund. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass nach gültiger Rechtsauffassung (Gutachten des DiJuF zu ärztlichen Aufklärungspflichten gegenüber gesetzlichen Betreuern und Erziehern, JAmt 2017, 542-545) psychiatrische Behandlungen nicht in den Bereich der „Angelegenheiten des täglichen Lebens“ oder der „ärztlichen Behandlung leichterer Erkrankungen und Verletzungen“ fallen, sondern sie stellen eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung dar, die zwingend den Einsatz des Vormunds erfordern. Aufklärungen v.a. zu Off-label-Behandlungen, die in unserem Fachgebiet häufig vorkommen, erfordern erhebliche Zeitressourcen seitens der Vormünder. Kinder unter Vormundschaft wiederum weisen erhebliche Risiken für einen psychiatrischen Behandlungsbedarf auf.
Zusätzlich seien uns zwei eher redaktionelle Hinweise gestattet:
a) Zu § 1795: Das Familiengericht muss nicht über einen Ausbildungsvertrag entscheiden der „für länger als ein Jahr geschlossen“ wird (die meisten Ausbildungen dauern 2 oder 3 Jahre) – sondern nach der Begründung ist gemeint: eine Ausbildung, die „länger als ein Jahr nach der Volljährigkeit andauert“, gleiches gilt für Dienstleistungen oder Mietverträge. Das kann unproblematisch nachgebessert werden, etwa analog zu § 1799 (2) „wenn das Vertragsverhältnis länger als ein Jahr nach dem Eintritt seiner Volljährigkeit fortdauern soll“
b) Die rechtlichen Verweise bei Entscheidungen hinsichtlich des Vermögens (§ 1798 (2)) landen alle bei Paragraphen, die das Betreuungsgericht betreffen. Das ist dahingehend missverständlich, als ob in den Fällen, wenn es um Vermögen ginge nicht mehr das Familiengericht zuständig wäre. Besser wäre es, hier zu ergänzen „gelten im Übrigen ……entsprechend gegenüber dem Familiengericht.
Abschließend danken wir Ihnen für diese Reforminitiative und stehen Ihnen jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.
Für den Vorstand, mit freundlichen Grüßen
Prof. M. Kölch, Präsident Prof. R. Schepker, Beisitzerin