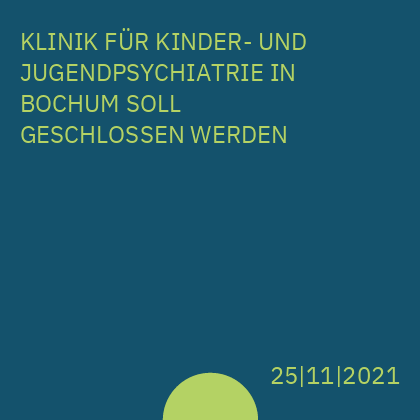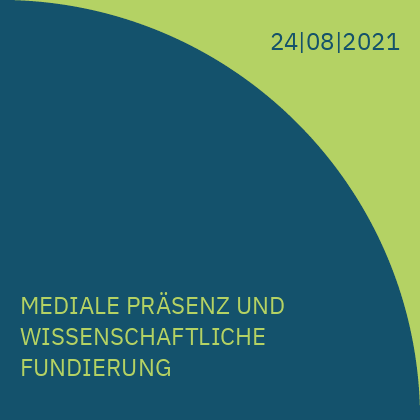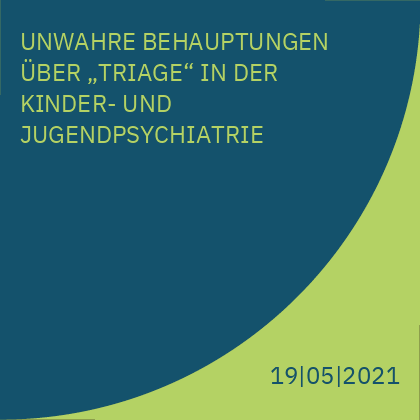G-BA-Projekt liefert neuen Ansatz zur Personalbemessung
Wieviel Personal braucht es für eine gute Therapie von Menschen mit psychischen Erkrankungen? Die medizinischen Fachgesellschaften Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) und die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) hatten dazu zusammen mit 20 weiteren Fachverbänden ein Modell entwickelt, das jetzt mit dem Projekt EPPIK wissenschaftlich evaluiert wurde. Damit liegt erstmals eine geprüfte Methode vor, den Personalbedarf in der stationären psychiatrischen Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zu ermitteln.
Das sogenannte „Plattformmodell“ bietet die Möglichkeit, notwendige Behandlungsprozesse und damit verbundene Personalbedarfe in der stationären Behandlung zu definieren. Es orientiert sich am Behandlungsbedarf psychisch erkrankter Menschen und betrachtet diesen auf verschiedenen, jeweils multidisziplinär besetzten Dimensionen: psychiatrisch-psychotherapeutisch, somatisch und psychosozial. Für jede dieser drei Dimensionen wird zwischen regulärem und erhöhtem Versorgungsbedarf unterschieden. So entstehen insgesamt acht Bedarfscluster.
Mit der vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) finanzierten Studie „Überprüfung der Eignung des ‚Plattformmodells‘ als Instrument zur Personalbemessung in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken (EPPIK)“ wurde das Modell nun empirisch getestet. Die Studie wurde in Kooperation mit den medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften DGPPN und DGKJP von einem multidisziplinären Projektteam aus Forschung, Beratung und Versorgung unter Koordination der Universität Ulm durchgeführt.
Für die Studie wurden Daten von fast 11.000 Patientinnen und Patienten aus insgesamt 54 Kliniken der Erwachsenen- bzw. Kinder- und Jugendpsychiatrie analysiert. Zunächst wurde überprüft, ob der jeweilige Behandlungsbedarf mit Hilfe des Plattformmodells reliabel eingeschätzt werden kann. Anschließend haben Expert_innen aus allen an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen gemeinsam mit Betroffenen erarbeitet, wie eine optimale Behandlung für Patient_innen in jedem der acht Bedarfscluster aussehen sollte. Hierfür wurde ausgehend von beispielhaften Fallvignetten bestimmt, welche Behandlungsbausteine und Tätigkeiten für die multiprofessionelle Behandlung von Patient_innen in jedem der Bedarfscluster notwendig sind und wieviel Zeit dafür benötigt wird. Schließlich wurde mit Hilfe der Delphi-Methode, einem systematischen, mehrstufigen Befragungs- und Schätzverfahren, ermittelt, wieviel Personal für die derart definierte Behandlung benötigt wird. Erste Ergebnisse des Projektes wurden im März bei einem Symposium vorgestellt.
„EPPIK liefert erstmals empirische Daten für ein Modell zur Personalbemessung in der stationären Psychiatrie“, ordnet Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg, Präsident der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft DGPPN, die Ergebnisse ein. „Es zeigt sich, dass der Behandlungsbedarf der Patient_innen reliabel eingeschätzt werden kann. Auch die Dimensionen des Modells bilden sich wie erwartet ab: So ist zum Beispiel in den Clustern mit einem erhöhten somatischen Bedarf auch der Zeitaufwand für die Pflege und die Ärzte_innen besonders hoch.“
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) Prof. Dr. Marcel Romanos ergänzt: „Die Studie hat aufgezeigt, wie eine Personalbemessung für eine moderne Behandlung psychiatrischer Patient_innen mittels Konsenses von Expert_innen entwickelt werden kann. Dieses Vorgehen ist unserer Erkenntnis nach weltweit einzigartig. Damit sind jetzt wichtige notwendige Bestandteile der multiprofessionellen Behandlung nachvollziehbar und auch der Personalbedarf dafür.“
Insgesamt liegt der durch EPPIK ermittelte Personalbedarf deutlich höher als die Mindestvorgaben der Personalrichtlinie PPP-RL. Allerdings beziehen sich die Vorgaben der PPP-RL auf mehr als 30 Jahre alte Personalzahlen und wurden ohne Evidenzgrundlage und ohne die Bezugnahme auf Leitlinien definiert. EPPIK geht dagegen von dem tatsächlichen Bedarf der Betroffenen aus. Die Differenz ist deshalb nicht verwunderlich.
Die psychiatrischen Fachgesellschaften DGPPN und DGKJP engagieren sich seit vielen Jahren für eine evidenzbasierte Personalbemessung in der Psychiatrie und Psychotherapie. Nachdem die Studie EPPIK nun bestätigt hat, dass das Plattformmodell für die Personalbemessung in der stationären Psychiatrie grundsätzlich geeignet ist, könnte der Ansatz auf andere Settings und Rahmenbedingungen übertragen werden. So ließe sich analog auch der Personalbedarf in der ambulanten Versorgung ermitteln.