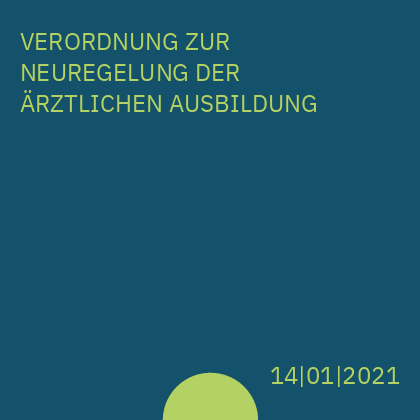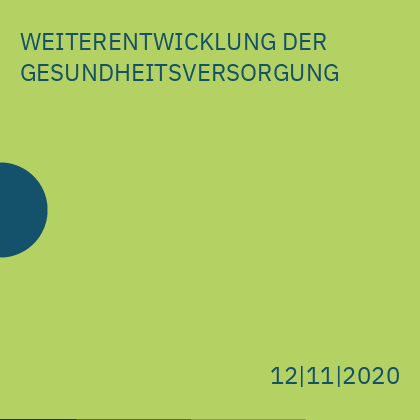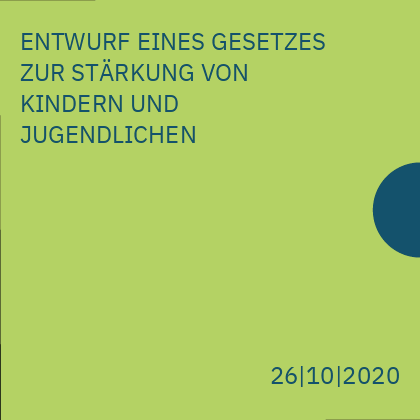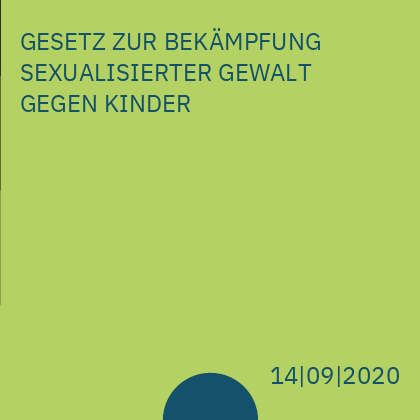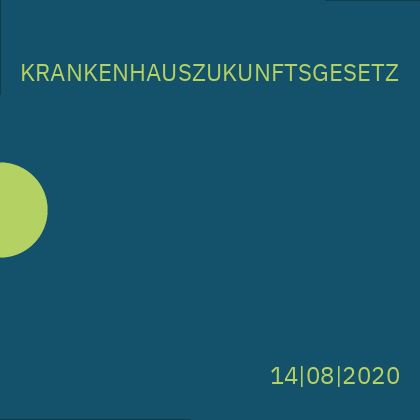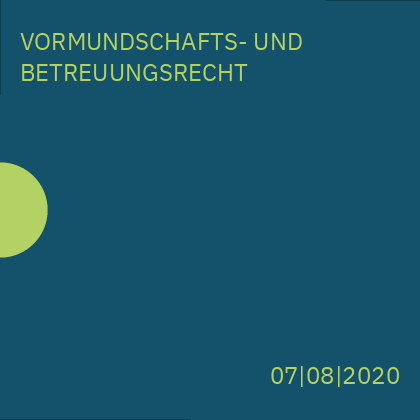Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen
(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG)
Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP), die Bundesarbeitsgemeinschaft der Leitenden Klinikärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V. (BAG KJPP) und der Berufsverband für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland e.V. (BKJPP) begrüßen ausdrücklich, dass nunmehr ein Reformvorschlag zum SGB VIII vorgelegt wird. Wir hatten bereits in der letzten Legislatur die Reform des SGB VIII unterstützt und waren enttäuscht, dass es nicht schon in der letzten Legislatur zu einer Reform gekommen ist. Wir haben uns aktiv in den Prozess der Reform, unter anderem im Dialog Forum „Mitreden Mitgestalten“ eingebracht und entsprechende Stellungnahmen und Positionspapiere beigetragen. Seitens der Kinder – und Jugendpsychiatrie wurde immer betont, dass der Weg – alternativlos vor der UN-BRK hin zu einer inklusiven Kinder – und Jugendhilfe gehen muss. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, die Zuständigkeit für alle Behinderungsformen unter der Zuständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe zusammenzuführen, da die bisherigen Regelungen eine künstliche Trennung vornahmen und sich für die Betroffenen nachteilig auswirkten.
Bereits im Prozess des Dialogs „Mitreden Mitgestalten“ haben wir ausdrücklich Regelungen begrüßt, welche
- die Selbstvertretung und Partizipation von Kindern, Jugendlichen und deren Familien stärken
- die Zusammenführung aller Hilfen für Kinder mit Behinderungen ermöglichen und komplexe Leistungen und Kombination unterschiedlicher Hilfen in der Jugendhilfe vorsehen
- die Hilfen für Kinder von psychisch kranken Eltern erleichtern und deren besondere Bedürfnisse berücksichtigen
- bessere Regelungen hinsichtlich der speziellen Bedürfnisse von Kindern in Pflegefamilien (Kontinuität, Entwicklungsperspektive) aber auch für Eltern von Kindern, die sich in Pflegestellen befinden (Beratung und Unterstützung) mit dem Ziel der besseren Entwicklungsperspektive für deren Kinder, vorsehen
- den Kinderschutz verbessern, indem sie die Kooperation zwischen Beteiligten im Kinderschutz fördern und stärken
- Qualitätsmerkmale in der Kinder- und Jugendhilfe weiterentwickeln
- bei jungen Erwachsenen die Fortführung von notwendigen Hilfen verbessern, so dass auch aus der Forschung bekannte Abbrüche mit negativer Auswirkung auf die langfristige Teilhabe besser verhindert werden können.
Wir unterstützen in weiten Teilen auch die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) vom 12.10.2020 und beschränken uns in dieser Stellungnahme auf die Teile des Entwurfs, die eine besondere Beziehung zu unserem Fachgebiet bzw. die Kooperation der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie (KJPP) mit der Kinder- und Jugendhilfe (KJH) zum Thema haben. Zusätzlich verweisen wir auf die bereits im Prozess „Mitreden – Mitgestalten“ abgegebenen Stellungnahmen und Beiträge.
Inklusive Kinder- und Jugendhilfe
Uns ist die Problematik bewusst, die aus einer Zusammenführung der Zuständigkeiten im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland resultieren. Dennoch sind wir dezidiert für eine verbindlichere und frühere Ausgestaltung der inklusiven Lösung. Im Sinne der Umsetzbarkeit und Machbarkeit akzeptieren wir zwar eine Übergangszeit, immer unter der Prämisse, dass sich am Ende tatsächlich eine inklusive Lösung für Kinder und Jugendliche und ihre Familien auch als gesetzliche Regelung finden wird. Wir bitten jedoch um Überprüfung einer möglichen Beschleunigung.
Gleichwohl begrüßen wir, dass eine solche Lösung nun überhaupt vorgesehen ist. Auch die notwendige wissenschaftliche Umsetzungsbegleitung und Folgeabschätzung der Regelungen sehen wir als sinnvoll an, ohne dass jedoch eine „Nullpunkterhebung“ das Umsetzen der Reform verzögern darf. Wir können aber unsere Sorge nicht verhehlen, dass die gefundene Lösung zu unverbindlich sein könnte, so dass unseres Erachtens eine stärkere gesetzgeberische Selbstverpflichtung, wie auch von der AGJ gefordert, notwendig wäre.
Die kinder- und jugendpsychiatrischen Verbände und die Fachgesellschaft werden einerseits weiter auf die Umsetzung einer inklusiven Lösung drängen und aus fachlicher Sicht auch weiterhin dafür werben und uns in diesem Feld besonders engagieren.
Kinderschutz
§ 8a Abs. 1 SGB VIII: Die Beteiligung von meldenden Berufsgeheimnisträger*innen an der Gefährdungseinschätzung je nach Erforderlichkeit im Einzelfall (mit einem stärkeren Einbezug des Gesundheitswesens) wird von uns ausdrücklich begrüßt. Der Zusatz, dass diese Beteiligung nur erfolgen solle, „sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist“, relativiert den Einbezug allerdings wieder. Wo immer möglich, sollte ein unmittelbarer Eindruck vom Kind regelhaft vorausgesetzt werden und nicht durch die Hürde einer fachlichen Einschätzung unangemessen gebremst werden. Hier ist das Vorgehen der Jugendämter mit dem ärztlichen Vorgehen zu vergleichen, in dem die persönliche Untersuchung ebenfalls Voraussetzung jeglicher Diagnose und Intervention ist.
§ 4 Abs. 1 und 2 KKG: Voranstellen der Befugnis zur Information des Jugendamts mit anschließender Schilderung der Voraussetzungen
Die Befugnis der Meldung durch Berufsangehörige, die ansonsten unter Schweigepflicht stehen, ist aus unserer Sicht zu begrüßen. Wichtig ist uns, dass im Gesetz darauf hingewiesen wird, dass eine Dokumentationspflicht für die wahrgenommene Kindeswohlgefährdung besteht. In Absatz 2 ist aus unserer Sicht zu ergänzen, dass vorab alle Möglichkeiten der eigenen Fachlichkeit, die Kindeswohlgefährdung abzuwenden, ausgeschöpft wurden – etwa der Versuch, von einer psychischen Störung betroffene Eltern zu einer Behandlung zu motivieren. Eine zu frühe Verantwortungsdelegation birgt die Gefahr, Chancen zu verpassen und das gewünschte interdisziplinäre Vorgehen im Kinderschutz wäre dadurch eher gefährdet. Auch kann nur so der Hinweis auf die Inanspruchnahme „öffentlicher Hilfen“ sinnvoll in einem Kontext stehen. Die Wahrnehmung eventueller medizinischer oder therapeutischer Hilfen ist von dem Begriff „öffentlicher Hilfen“ ja nicht mit umfasst.
§ 5 KKG: Information des Jugendamts durch die Strafverfolgungsbehörden bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung
Hier scheint uns bedeutsam, dass die „Strafverfolgungsbehörden“ zum Erreichen des angestrebten lückenlosen Kinderschutzes noch durch „Strafvollstreckungsbehörden“ ergänzt werden, was den Maßregelvollzug der Länder mit umfassen sollte. Es ginge dabei z.B. um die Durchsetzung eines Verbotes gegenüber pädophilen Täter*innen, sich erneut in häusliche Gemeinschaft mit Kindern zu begeben.
§ 73c SGB V: Gebot zu Kooperationsvereinbarungen zwischen Kassenärztlicher Vereinigung und Jugendämtern
Die kinder- und jugendpsychiatrische Fachgesellschaft und die Fachverbände setzen sich bereits seit vielen Jahren für eine Kodifizierung der Kooperation zwischen der in unserem Fach überwiegend ambulant aufgestellten ärztlich-psychotherapeutischen Versorgung mit den Jugendämtern ein, einschließlich deren Vergütung. Ein Problem sehen wir in der Verengung dieser Kooperation auf eine Kindeswohlgefährdung. „Jugendpsychiatrische Verbünde“ sind auch z.B. bei (drohender) seelischer Behinderung erforderlich, in diesem Zusammenhang dürften sie sogar häufiger nötig sein als bei einer Kindeswohlgefährdung. So ist etwa die Teilnahme eines Kinder- und Jugendpsychiaters an der Hilfeplanung nach § 36 SGB VIII sehr oft deshalb nicht möglich, weil eine Finanzierung der zeitaufwändigen Teilnahme an Hilfeplangesprächen, die i.d.R. auch noch außerhalb der Praxisräume stattfinden, weder für den Arzt noch für dessen qualifizierte Mitarbeiter gegeben ist. Die Finanzierungsfrage für Fälle mit Kindeswohlgefährdung wird im Gesetz adressiert, die Erweiterung auch über den Kinderschutz hinaus kann in der Neufassung § 73c SGB V noch geheilt werden. Nach den Ausführungen der Gesetzesbegründung des Referentenentwurfs (S. 142) gehen wir davon aus, dass diese Kooperation auch im Sinne einer erweiterten Sichtweise über den Kinderschutz hinausgehend als sinnvoll eingeschätzt wird.
§ 37b SGB VIII: Sicherung der Rechte von Kindern in Pflegefamilien durch Schutzkonzepte sowie Beschwerdemöglichkeiten
Eine Sicherung der Rechte von Pflegekindern und Schutz vor Gewalt halten wir für dringend notwendig. Dazu bedarf es allerdings auch einer personellen Verstärkung der Jugendämter. Vor allem psychisch kranke und seelisch behinderte Kinder, die in Pflegefamilien deutlich überrepräsentiert sind, bedürfen einer qualifizierten Begleitung und Triangulierung (etwa um nicht in dauerhafte Loyalitätskonflikte zu geraten) durch das Jugendamt. Eine Abgrenzung zur Rolle von Vormündern sollte gegebenenfalls im Einzelfall getroffen werden; hier werden auch im neuen Vormundschaftsrecht des BMJV Regelungen erwartet. Besonders wichtig ist uns, dass die Beschwerdestellen unabhängig von der Stelle, welche die Hilfen gewährt, agieren können. Hier sind die „Möglichkeiten der Beschwerde“ in § 37b (2) noch zu wenig konkret gefasst.
Hilfen zur Erziehung nach § 27 und nach §35a SGB VIII
§ 27 (2) Kombination von Hilfen: Die vorgesehene Regelung ist sehr sinnvoll und alle Forschung zeigt, dass ein „entweder oder“ in komplexen Fallkonstellationen oft nicht zielführend ist. Dabei wird Augenmaß und eine Prüfmöglichkeit der Wirksamkeit der Kombination von Hilfen gegeben sein müssen. Es wird beobachtet werden müssen, inwieweit eine Leistungsausweitung auch tatsächlich Nutzen für das betroffene Kind oder den betroffenen Jugendlichen und seine Familie erbringt.
§ 27 Abs. 3 S. 2 SGB VIII: Möglichkeit von Pooling-Angeboten bei der Schulbegleitung
Auch diese Regelung wird seitens der kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände und der Fachgesellschaft sehr unterstützt, um absurde Situationen in der Praxis zu vermeiden, Stigmatisierung einzelner Schüler zu verringern und eine bessere Qualität der Hilfen und der Inklusion zu sichern. Gleichwohl sehen wir, dass die Schulen zur Entwicklung eigener Konzepte gefordert sind, die bisher nicht hinreichend existieren. Gerade auch im Bereich psychisch kranker Kinder/Jugendlicher fehlen diese, und aus unserer Sicht wird das Schulsystem hier dem Inklusionsauftrag nur unzureichend gerecht. Die KJH fungiert hier allzu oft als Ausfallbürge, ebenso verhält es sich (je nach Bundesland stärker oder weniger stark) im Bereich der Teilleistungsstörungen wie z.B. den Lese-Rechtschreibstörungen. An dieser Schnittstelle bieten wir gerne weiteren fachlichen Input an.
§ 35a SGB VIII:
Bei dieser Rechtsnorm sehen wir als kinder- und jugendpsychiatrischen Fachverbände und Fachgesellschaf eine zu große Zurückhaltung des Gesetzgebers vor notwendigen Überarbeitungen.
Der Behinderungsbegriff sollte aus unserer Sicht der dem in § 2 SGB IX angeglichen werden. Dies umso mehr, als die KJH sich bei der Feststellung der Teilhabebeeinträchtigung vielfach bereits der Methoden bedient, die nun auch im SGB IX verstärkt Beachtung finden, nämlich der individuellen Einschätzung der Wechselwirkungen von Umwelt und Person.
Aus medizinischer Sicht bleibt die fortbestehende Formulierung „Dabei ist auch darzulegen, ob die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer Krankheit beruht“ weiterhin etwas sinnleer, da eine Diagnose nach ICD-10 bzw. der gültigen medizinischen Klassifikation immer Krankheitswert hat. Sinnvoller wäre es, dezidierter eine Erläuterung dahingehend zu fordern, inwieweit die festgestellte psychische Störung (= Krankheit) Auswirkungen auf die Teilhabefähigkeiten hat. In der weiter tradierten Fassung handelt es sich aus medizinischer Perspektive um eine Tautologie. Dies wurde seitens der KJPP bereits wiederholt dargelegt. Die Fortschreibung dieser Tautologie verhindert in praxi insofern die Kooperation, als damit ein Missverständnis perpetuiert wird, welches immer wieder Klärungsbedarf für bereits klare Sachverhalte notwendig macht. Daher setzen wir uns dafür ein, den Satz zu streichen und stattdessen gegebenenfalls auf das Bundesteilhabegesetz und die ICF zu verweisen.
Die Einfügung zur angemessenen Berücksichtigung von Ausführungen zu Absatz 1 Nummer 2 begrüßen wir ausdrücklich. In der Praxis findet dies oftmals bereits statt. Sowohl die KJH als auch die KJPP werben in ihrem jeweiligen Bereich stets für die Kooperation und die Kenntnis der jeweiligen Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Partners im jeweils komplementären Bereich. Ob sich in der Praxis eine Änderung ergeben wird in den Fällen, in denen das bisherige Vorgehen Probleme ergeben hat, muss abgewartet werden. Letztlich wird es in strittigen Fällen auf Sorgeberechtige ankommen, die verwaltungsgerichtliche Klärungen herbeiführen. Gleichwohl, dies sei nochmals unterstrichen, unterstützen wir die Einfügung, da diese damit gesetzlich die Berücksichtigung zur Regel macht, und sind bestrebt, hier in der Weiter- und Fortbildung (vgl. hierzu die neue Musterweiterbildungsordnung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie) detaillierte Kenntnisse über die Feststellung von Teilhabebeeinträchtigungen und die möglichen Hilfen zu vermitteln.
Zur Problematik der „Gutachten“ vs. „Stellungnahmen“, die sich aus § 17 SGB IX ergibt, vgl. auch die Stellungnahme der AGJ. Ganz abgesehen davon, dass wir im Sinne der Familien zügige Verfahren ausdrücklich unterstützen, muss gleichwohl an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass eine entsprechende ärztliche Diagnostik nach §35a SGB VIII bei bisher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht bekannten Kindern und Jugendlichen oftmals nicht innerhalb der Fristen nach dem SGB IX möglich sein wird.
§ 36 SGB VIII:
§ 36 (2) Die Berücksichtigung der Geschwisterbeziehungen in der Hilfeplanung halten wir auch aus entwicklungspsychologischer Sicht für unerlässlich und von daher die gewählte Formulierung für äußerst gelungen.
Auch die Hinzufügung § 36 (3) halten wir für sinnvoll. Sie entspricht der vielerorts bereits gängigen Praxis integrierter Hilfeerbringung und ist insbesondere für seelisch behinderte Kinder mit komplexem Hilfebedarf unerlässlich.
§ 38 SGB VIII: Regelung der (engen) Voraussetzungen einer Hilfeerbringung im Ausland (wichtigste Kriterien: Vorliegen einer Betriebserlaubnis für den Träger im Inland, Qualitätsvereinbarung, Gewähr der Anzeige von potenziell gefährdenden Ereignissen; Einhaltung der Rechtsvorschriften im Ausland und Zusammenarbeit mit entsprechenden Behörden)
Generell ist aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht eine „Auslandsmaßnahme“ nur in sehr wenigen Einzelfällen tatsächlich zu erwägen. Auslandsmaßnahmen spiegeln aus unserer Sicht letztlich ein unzureichendes Hilfesystem in der Bundesrepublik Deutschland, das den betreffenden Kindern und Jugendlichen, die regelhaft meist der Unterstützung aus mehreren Systemen bedürfen (u.a. aus dem Bereich des SGB V), keine hinreichenden Angebote machen kann. Die vorgesehene regelhafte Einbeziehung der Expertise der KJPP (§ 38 (2) Satz 1) spiegelt wider, dass es sich hierbei um Kinder und Jugendliche handelt, die meist sowohl im Bereich der KJH als auch der KJPP (lange) bekannt sind. Aus unserer Sicht wäre die kooperative Entwicklung von entsprechenden Angeboten im Inland deutlich angemessener, begleitet von einer entsprechenden Qualitätsentwicklung der Angebote.
Problematisch erscheint uns die Frage einer Sicherstellung des Rechts der Kinder auf Leistungen aus dem SGB-V im Ausland. Gerade diese Kinder und Jugendlichen (wie auch die Einholung der Stellungnahme nach § 35a SGB VIII zeigt) bedürfen oft in besonderem Ausmaß der Hilfen aus beiden Systemen. Kinder- und Jugendpsychiatrie und psychotherapie ist im Ausland sehr unterschiedlich ausgestaltet und wie das Recht der Kinder im Ausland sichergestellt werden soll, ist nicht geregelt. Insofern würden wir § 38 (2) Satz 2 so interpretieren, dass eine festgestellte, behandlungsbedürftige kinder- und jugendpsychiatrische Störung eine Auslandsmaßnahme in aller Regel ausschließt. Leider ist dem Begründungstext nicht zu entnehmen, ob der Gesetzgeber diese Vorgabe ebenso sieht.
Kinder psychisch kranker Eltern
§ 28a SGB VIII: Integration der Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen in den Katalog der Hilfen zur Erziehung bei Ausfall eines für die Betreuung verantwortlichen Elternteils
sowie
§ 36a Abs. 2 S. 1 Halbs. 2 SGB VIII: Ausdrückliche Erweiterung der Möglichkeit zur niedrigschwelligen Inanspruchnahme um Hilfe in Notsituationen, wenn diese Hilfe von einer Beratungsstelle nach § 28 SGB VIII zusätzlich angeboten oder vermittelt wird
Der Begriff „ausfällt“ könnte missverstanden werden. Es geht letztlich darum, dass die Eltern nicht ausreichend zur Verfügung stehen, insofern wäre eine andere Formulierung (vgl. auch AGJ Stellungnahme) wünschenswert.
Wir begrüßen die Einführung von ehrenamtlichen Pat*innen. Wir verstehen dies so, dass damit bisher nicht mögliche Hilfen institutionell ermöglicht werden und damit die Grauzone der Privatheit verlassen wird/werden kann, und dass dabei aber auch kontinuierliche Unterstützungspersonen, die nicht ehrenamtlich, sondern ggfs. als HzE bereits tätig sind, ebenso gemeint sein können. Das Modell der „Pat*innen“ als ehrenamtliche, stabile Bezugspersonen sowohl in gesunden als auch dekompensierten Phasen der psychisch erkrankten Eltern hat sich an einigen Orten bereits gut bewährt; die professionelle Anleitung und Begleitung der Ehrenamtlichen ist dabei absolut erforderlich.
Pflegekinder
§ 36 Abs. 1 S. 2 SGB VIII: Pflicht zur Sicherstellung einer wahrnehmbaren Beratung und Aufklärung von personensorgeberechtigten Eltern und Kindern im Rahmen der Hilfeplanung (s.a. V.)
§ 36 Abs. 2 S. 2 SGB VIII: Schutz von Geschwisterbeziehungen: Prüfung gemeinsamer Unterbringung oder Aufrechterhaltung des Kontakts
§ 36 Abs. 5 SGB VIII: Einbeziehung nicht sorgeberechtigter Eltern in die Hilfeplanung je nach Erfordernis im Einzelfall, Berücksichtigung der Interessen des Kindes sowie der Willensäußerung des/der Personensorgeberechtigten bei der Einschätzung der Erforderlichkeit
§ 37 Abs. 1 SGB VIII: Individueller Rechtsanspruch auf Beratung und Unterstützung sowie Förderung der Beziehung zum Kind bei Unterbringung außerhalb der Familie unabhängig von Personensorge und unabhängig von Rückkehroption
§ 37 Abs. 2 SGB VIII: Verbindliche Förderung des Zusammenwirkens von Eltern und Pflegeeltern/Einrichtung durch das Jugendamt (leichte Umformulierung des Hinwirkens auf die Zusammenarbeit in § 37 Abs. 1 S. 1 aF)
§ 1632 Abs. 4 BGB: Möglichkeit der Dauerverbleibensanordnung (Voraussetzungen: 1. Verbesserung in der Herkunftsfamilie wurde innerhalb eines für das Kind vertretbaren Zeitraums nicht erreicht und ist auch zukünftig mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreichbar; 2. Erforderlichkeit zum Wohl des Kindes)
Die Regelungen zur verbesserten Perspektivplanung, der besseren Berücksichtigung entwicklungs-psychologischer Bedürfnisse der Kinder, der Möglichkeiten Beziehungsabbrüche zu minimieren sind aus unserer fachlichen Sicht sehr sinnvoll und werden unterstützt. Die entsprechenden Regelungen der Beratung auch von nicht personensorgeberechtigten Eltern, zu denen dennoch eine kindliche Loyalität bestehen kann, sind fachlich sehr zu begrüßen und dringend notwendig. Wir unterstützen aus fachlicher Sicht insbesondere, dass der Zeitperspektive eine hohe Bedeutung zukommt. Oft kann ein Kind sich auch deswegen nicht auf eigene Entwicklungsperspektiven einlassen, da noch nicht hinreichend für die Eltern „gesorgt“ worden ist.
Bezüglich der geplanten Regelung im BGB (§ 1696 Abs.3) finden wir die gewählte Formulierung hochproblematisch, da sie ohne Kriterien eine Rückführung von Kindern in eine gefährdende Situation ermöglichen könnte. Wir verweisen hier auf die Stellungnahme der APK, sowie die in den mündlichen Anhörungen geäußerten Bedenken und halten eine Änderung für unabdingbar.
Junge Erwachsene
§ 94 Abs. 6 SGB VIII: Reduzierung des Kostenbeitrags auf höchstens 25 % des aktuellen Einkommens
Wir begrüßen diese Regelung. Wir verweisen an dieser Stelle auch auf die Stellungnahme der AGJ.
§ 36 b Gestaltung von Übergängen:
Wir begrüßen insbesondere den Verweis auf das Bundesteilhabegesetz/ § 121 SGB IX und den verpflichtenden Einbezug der behandelnden Ärzte. Bei seelischer Behinderung wäre uns allerdings wichtig, explizit den behandelnden Kinder- und Jugendpsychiater und psychotherapeuten zu benennen, da bei Mehrfachbehinderungen sehr oft auch mehrere Fachdisziplinen an der Behandlung beteiligt sind.
§ 41 SGB VIII:
Die Erweiterung der Hilfemöglichkeiten entspricht auch allen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entsprechenden Jugendlichen/jungen Erwachsenen, die meist einen längerdauernden, zum Teil auch fluktuierenden Bedarf an Maßnahmen zur Hilfe zu einem eigenständigen Leben haben. Wir begrüßen verbindlichere Regelungen zur Fortführung von Hilfen und insbesondere die Möglichkeit eine neue Hilfe nach dem 18. Lebensjahr auch nach Beendigung einer Hilfe zu etablieren ausdrücklich.
Bezüglich der Formulierung wäre ggfs. „…ihre Persönlichkeitsentwicklung und/oder die Lebensumstände“ geeigneter. Es sollte zumindest auf die entwicklungstypischen Bedarfe etwa durch Schule, Ausbildung, oder auch Lebensbedingungen wie Freiwilliges soziales Jahr etc. Bezug genommen werden.
Partizipation
§ 9a SGB VIII: Verpflichtung des überörtlichen Trägers zur Einrichtung einer zentralen Ombudsstelle oder einer vergleichbaren Stelle
Aus dem Bereich der KJPP liegen sehr gute Erfahrungen mit Beschwerdestellen vor. Daher wird diese Regelung explizit begrüßt. Kinder und Jugendliche sollten in allen Systemen die Möglichkeiten zur Beschwerde erhalten und in ihren jeweiligen Sichtweisen und Bedürfnissen ernst genommen werden.
Auch die Klarstellung in §36 (1) begrüßen wir sehr, da damit die Rechte von Kindern auf Partizipation im Verfahren eindeutig gestärkt werden.
Schleswig/ Mainz/ Berlin, 25.10.2020