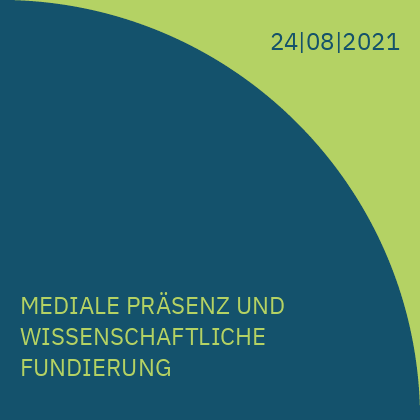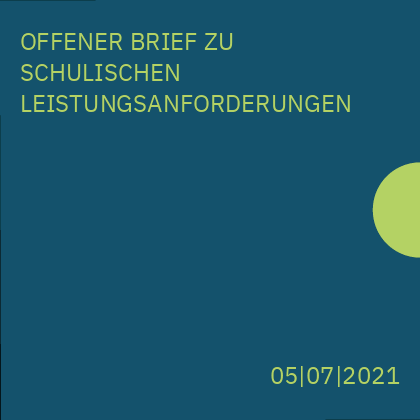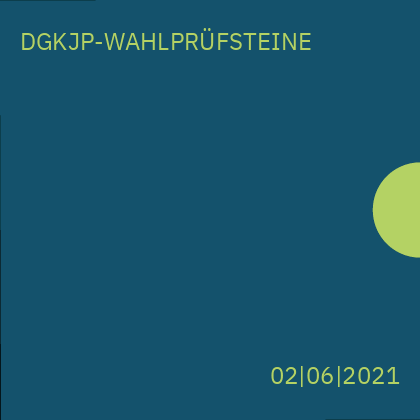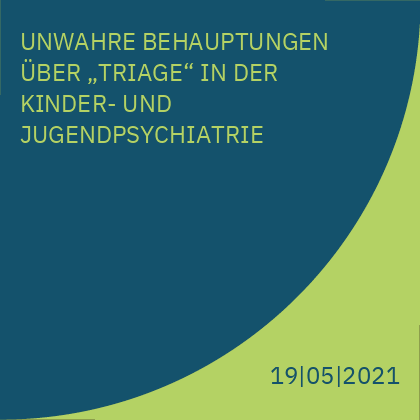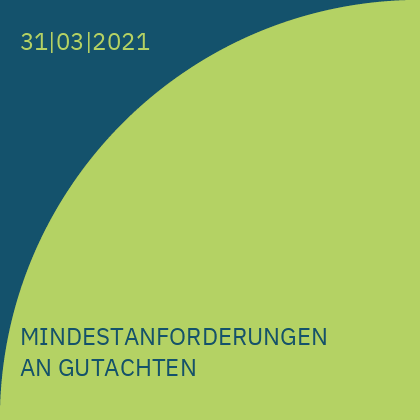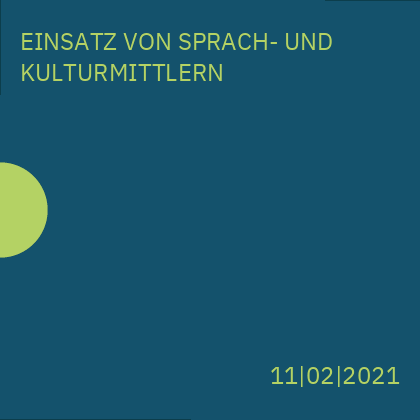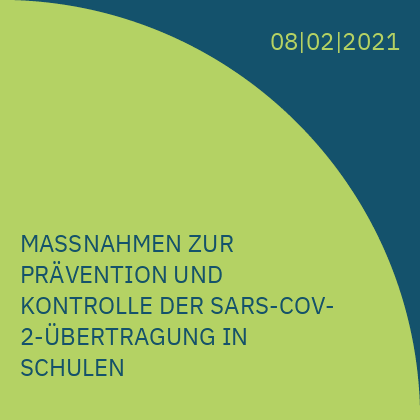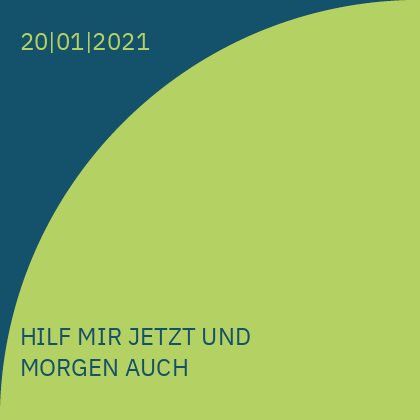Einsatz von Sprach- und Kulturmittlern in der psychotherapeutischen Versorgung von geflüchteten Kindern, Jugendlichen, ihren Familien und Bezugspersonen:
Empfehlungen für die klinische Praxis
Zusammenfassung
Psychotherapie mit Sprach- und Kulturmittlern ist anspruchsvoll und stellt spezifische Herausforderungen an alle Beteiligten. Gleichzeitig können darüber auch Ressourcen generiert werden, die den therapeutischen Prozess positiv beeinflussen. In diesem Papier werden Probleme und Chancen bei der Arbeit mit Dolmetscherinnen im psychiatrischen/psychotherapeutischen Versorgungskontext von geflüchteten Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Es werden Empfehlungen gegeben, wie die Zusammenarbeit mit Dolmetschenden im Versorgungskontext von Kindern und Jugendlichen optimiert werden kann, um einen Beitrag zur Etablierung von Qualitätsstandards zu leisten .
1. Hintergrund
Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ist Psychotherapie mit Dolmetscherinnen grundsätzlich genauso effektiv wie muttersprachliche Psychotherapie (Brune, Eiroá-Orosa, Fischer-Ortman, Delijaj, u. Haasen, 2011; Lambert u. Alhassoon, 2015). Auch Erfahrungen aus der Praxis bestätigen dies weitestgehend, wobei in Einzelfällen durchaus auch negative Erfahrungen berichtet werden, wenn die Dolmetscherinnen und Therapeutinnen hinsichtlich Sprachmittlung oder transkultureller Sensibilität unzureichend ausgebildet oder reflektiert waren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit von einheitlichen Qualitätsstandards für den Dolmetscherinneneinsatz im psychiatrischen bzw. psychotherapeutischen Kontext sowie im Hinblick auf transkulturell sensible Sprachmittlung. Aktuelle Forschungsarbeiten beschäftigen sich daher mit Besonderheiten, Chancen und Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen und der Frage, wie „Psychotherapie zu dritt“ sinnvoll gestaltet werden kann (Morina, Maier u. Mast, 2010; Wolf u. Özkan, 2012; Boss-Prieto, De Roten, Elghezouani, Madera, u. Despland, 2010; Reher u. Metzner, 2016; Schepker u. Toker, 2009).
Neben Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung der Zusammenarbeit mit Dolmetschenden möchten wir auch auf Besonderheiten auf struktureller Ebene hinweisen, deren Berücksichtigung einen wesentlichen Einfluss auf die Qualitätssicherung hat. So wird oft nicht hinreichend beachtet, dass die Zusammenarbeit mit Dolmetschenden mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden ist, welchem durch zusätzliche personelle als auch finanzielle Ressourcen Rechnung getragen werden muss.
Ziel des vorliegenden Beitrags ist, für das spezifische Setting der psychotherapeutischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen einen Überblick über Empfehlungen aus Wissenschaft und Praxis zu geben um damit einen Beitrag zur professionellen Handlungssicherheit in der Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen zu leisten.
2. Professionelle Dolmetscherinnen
Im psychiatrisch-psychotherapeutischen Kontext sollten keine Laien- oder Ad-hoc-Dolmetscherinnen (z. B. Familienangehörige oder Krankenhausangestellte) eingesetzt werden, da hierdurch hohe Fehlerquoten und nachfolgend beschriebene unerwünschte negative Nebenwirkungen entstehen (Morina et al., 2010; Salman, 2002; Schepker u. Toker, 2009). Die Praxis zeigt jedoch, dass dies nach wie vor häufig, vor allem im stationären Kontext und in Akutsituationen, geschieht, da keine professionellen Dolmetscherinnen verfügbar sind oder die zusätzlich anfallenden Kosten nicht abgerechnet werden können (Baron u. Flory, 2017). In der psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist eine Indikation zum Dolmetscherinneneinsatz auch gegeben, wenn die Patientinnen selbst die deutsche Sprache bereits ausreichend beherrschen, ihre Bezugspersonen jedoch nicht. Immer wieder kommt es in solchen Situation außerhalb des therapeutischen Rahmens zu Überforderungen und Rollendiffusionen, da die Kinder für ihre Eltern dolmetschen müssen. So sind Kinder und Jugendliche häufig gehemmt, mit Familienangehörigen über intime oder emotional belastende Themen zu sprechen. In der Rolle des Dolmetschenden bei Familiengesprächen setzt man sie daher nicht nur einer potentiellen emotionalen Überforderung aus, sondern geht auch die Gefahr ein, dass Inhalte „gefiltert“ übersetzt werden. Man überlässt ihnen die Verantwortung darüber, welche Inhalte sie in welcher Art und Weise den jeweiligen Parteien mitteilen. So werden schambehaftete Themen eventuell nicht übersetzt, was wiederum zu intrapsychischen Konflikten des Kindes/Jugendlichen als auch zu Störungen innerhalb des Familiensystems führen kann. Diese Umstände machen eine professionelle therapeutische Arbeit unmöglich und erhöhen die Gefahr von Fehlbehandlungen.
2.1 Anforderungen an Dolmetscher
Dolmetschen ist eine komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit. Es erfordert neben sprachlichen Fähigkeiten, eine hohe Konzentrationsfähigkeit, eine gewisse kognitive Reife, ein gutes Bildungsniveau sowie ein hohes Reflexionsvermögen. Dolmetscherinnen sollten in der Lage sein, kulturgebundene Ausdrücke einordnen und erklären zu können (Wolf u. Özkan, 2012). Dolmetscherinnen müssen eine professionelle Haltung einnehmen und ethische Regeln einhalten. Gemeint sind Wahrung der Schweigepflicht, Neutralität, Allparteilichkeit, Loyalität im Umgang mit Patientinnen und Therapeutinnen (Morina et al., 2010) sowie Rollenklarheit. Sie sollten zudem ein Verständnis für psychiatrische/psychotherapeutische Arbeit mitbringen. Nicht zu unterschätzen ist die emotionale Belastung, die beispielweise durch Übersetzung traumatischer Inhalte entsteht, mit der Dolmetschende zurechtkommen müssen. Eine hinreichende emotionale Stabilität und professionelle Psychohygiene sind daher wichtige Voraussetzungen für die Arbeit.
3. Empfehlungen zur Qualitätssicherung bei dolmetschergestützten Therapiegesprächen
Der wichtigste Wirkfaktor bei der therapeutischen Arbeit ist die Beziehung zwischen Therapeutin und Patientin. Bei der Arbeit mit Dolmetscherinnen im therapeutischen Setting wird die therapeutische Dyade durch die Dolmetscherin zu einer Triade ausgeweitet und damit auch jeweils eine zusätzliche Beziehung zur Dolmetscherin eingegangen. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, dass eine Dolmetscherin den gesamten diagnostischen und psychotherapeutischen Prozess begleitet, sofern die initiale Passung stimmt. Letztere sollte nach dem Erstkontakt von der Patientin erfragt werden, idealerweise in Abwesenheit der Dolmetscherin. Eine personelle Kontinuität in der therapeutischen Arbeit schafft Vertrauen und erleichtert der Patientin in der Praxis oft, sich zu öffnen, um sich auf den therapeutischen Prozess einlassen zu können.
3.1 Innere Haltung
Grundsätzlich ist eine respektvolle und wertschätzende Haltung bezüglich individueller Unterschiede in der Zusammenarbeit zwischen Dolmetscherin, Therapeutin und der Patientin wichtig. Darüber hinaus bilden hohe Transparenz, Klarheit über Regeln, Geduld und Offenheit auf allen Seiten die Basis für ein offenes und vertrauensvolles Miteinander.
3.2 Vor dem Gespräch
Der Kontakt zwischen Dolmetscherin und Patientin im Wartebereich sollte auf ein professionelles Mindestmaß reduziert sein. Bevorzugt wird, dass die Dolmetscherin vor dem Sitzungsbeginn getrennt von der Patientin wartet, sofern dies die räumlichen Gegebenheiten zulassen. Eine kurz gehaltene Begrüßung der Patientin durch die Dolmetscherin ist selbstverständlich möglich, wenn beide sich im Wartebereich sehen. Diese Vorgabe dient der Rollenklarheit und dem Schutz der Dolmetscherin vor Zusatzaufträgen durch die Patientinnen, dies sollte gegebenenfalls auch gegenüber diesen erläutert und als institutionelle Vorgabe begründet werden.
3.2.1 Dolmetscherinnenvorgespräch
Ein Vorgespräch zwischen Therapeutin und Dolmetscherin stellt eine wichtige Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit dar. Dadurch wird gewährleistet, dass die dolmetschende Person bereits im Raum ist, bevor die Patientin eintritt. Zudem verdeutlichen Therapeutin und Dolmetscherin damit ihr Selbstverständnis als Team gegenüber der Patientin.
In der Praxis hat es sich bewährt, sich für das erste Vorgespräch etwas mehr Zeit zu nehmen (ca. 10-15 min) und mit der Dolmetscherin über Erwartungen und Anforderungen an die Zusammenarbeit zu sprechen. Es wird eine Wort-für-Wort-Übersetzung angestrebt, die jedoch in der Praxis nicht uneingeschränkt umsetzbar ist. Manche sprachlichen Ausdrücke sind stark kulturell geprägt und müssen daher teilweise in ihrem Sinn übersetzt werden, um richtig eingeordnet und verstanden werden zu können. Insbesondere die Verwendung einer Metapher kann in unterschiedlichen Sprachen eine sehr unterschiedliche Bedeutung haben, was bei einer Wort-für-Wort-Übersetzung zu Missverständnissen oder Verfälschungen des Sinngehalts führen kann. Sie sollten daher von Therapeutinnen eingeleitet und in ihrer Bedeutung erklärt werden. Verwenden Patientinnen Metaphern sollte deren Bedeutung von der Therapeutin niederschwellig erfragt werden .
Es ist darüber hinaus wichtig, über die Schweigepflicht aufzuklären. Unmittelbare Rückmeldungen zu Übersetzungsqualität und -technik sollten ebenfalls vereinbart und in das Nachgespräch integriert werden.
Die Vorgespräche bei weiteren Therapiesitzungen nach dem Ersttermin können kürzer ausfallen bzw. haben andere Schwerpunkte. Grundsätzlich sollte kurz über Ziele und Erwartungen an das Gespräch informiert werden. Wenn bestimmte therapeutische Interventionen geplant sind (z. B. Imaginationsübungen), sollten diese kurz erklärt werden, um Irritationen zu vermeiden und damit sich die Dolmetscherin darauf einstellen kann.
3.3 Während des Gesprächs
Im Erstgespräch sollte eine Vorstellungsrunde zum Abbau von Ängsten und Unsicherheiten sowie zur Rollenklärung erfolgen. Danach sollte die Patientin im Detail über den Dolmetscherinneneinsatz aufgeklärt werden, vor allem über die Schweigepflicht, die konsekutive Übersetzung in der Ich-Form und damit die Übersetzung von ausnahmslos allem, was während der Sitzung gesprochen wird.
Bei dieser Gelegenheit sollte auch geklärt werden, ob sich Patientin und Dolmetscherin bereits aus einem anderen Kontext kennen. Zwischen Dolmetscherin und Patientin sollte außerhalb der Sitzungen kein privater Kontakt bestehen. Sollte dies anders sein oder ist die Patientin bereits vor der ersten Sitzung der Dolmetschenden bekannt, muss dies von dieser gegenüber der Therapeutin angesprochen werden. Es soll offen besprochen werden, in wie fern dies die Zusammenarbeit beeinflusst und ob ein Dolmetscherinnenwechsel sinnvoll ist.
Gerade in kleinen sprachlichen, ethnischen, politischen oder religiösen Diaspora-Gemeinschaften ist es oft schwer, entsprechend „neutrale“ Übersetzerinnen zu finden. Mitunter ist die Möglichkeit zu prüfen, in einer Drittsprache zu sprechen oder mit technischen Übersetzungshilfen oder telefonischen Übersetzungsdiensten zu arbeiten.
3.3.1 Gesprächsgestaltung
Für die Gestaltung dolmetschergestützter Therapiegespräche geben Walter u. Adam (2003) sowie Morina et al. (2010) eine gute Orientierung. Insbesondere folgende Hinweise haben sich in der Praxis bewährt: Die Therapeutin hält mit der Patientin Blickkontakt und spricht sie direkt an. Die Gesprächseinheiten sollten auf beiden Seiten von Therapeutin und Patientin möglichst kurz gehalten werden (zwei bis vier Sätze). Durch ein jeweiliges kurzes Handzeichen, das im Vorfeld mit allen Beteiligten besprochen wurde, sollen längere Gesprächspassagen unterbrochen werden, um das bis dahin Gesagte zu übersetzen. Diese trägt maßgeblich zur Qualität der Übersetzung bei.
Seitens der Therapeutin soll auf eine leicht verständliche Ausdrucksweise geachtet werden. Komplizierte Nebensätze, Fachjargon und typisch deutschsprachige Redewendungen sollten vermieden werden, da diese oft missverstanden werden, oder nicht eins zu eins übersetzt werden können. Dolmetscherinnen sollen explizit darauf hingewiesen werden bei Unklarheiten um eine Umschreibung des Gesagten zu bitten. Sofern Fragen aufkommen oder auch Irritationen und Konflikte entstehen, sollen diese transparent gemacht werden, damit gemeinsam nach Lösungen gesucht werden kann. Metaphern sollten möglichst direkt übersetzt werden, da sie wesentliche kulturelle Zugänge erlauben. Damit dies gelingen kann, ist das Schaffen einer vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre für alle Beteiligten unerlässlich.
3.4 Rollenverständnis
Es gibt unterschiedliche Ansätze zum Rollenverständnis von Therapeutin und Dolmetscherin in der Therapie. Die Rollen sollten definiert sein und nach dem Erstgespräch reflektiert werden. Im Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, bei dem die Gestaltung der therapeutischen Arbeit ausschließlich bei der Therapeutin liegt und die Dolmetscherin inhaltlich keinen Einfluss auf die Sitzungsgestaltung nimmt. Andere Ansätze beziehen die Dolmetscherin bei entsprechender Vorbildung als Ko-Therapeutin oder teilnehmende Beobachterin ein. Diese werden hier nicht beschrieben, können aber unter besonderen Umständen zur Anwendung kommen.
3.4.1 Therapeutin
Während der therapeutischen Sitzung ist die Therapeutin für die Gesprächsführung zuständig und trägt die Verantwortung für den gesamten therapeutischen Prozess und die Einhaltung der zuvor besprochenen Gesprächsregeln.
3.4.2 Dolmetscherin
Dolmetscherinnen haben im Kontakt mit Patientinnen eine Sprachmittlerfunktion und tragen die Verantwortung dafür, dass alles Gesagte gedolmetscht wird. Auch Zwischenfragen, Unverständnis und Wiederholungen sollten explizit mit übersetzt werden, da sie diagnostisch wichtig sein können. Die Wiedergabe sollte in beide Richtungen in der ersten Person erfolgen (Abdallah-Steinkopff, 2000). Sofern es um hochbelastende Inhalte, wie traumatische Erfahrungen geht, kann die dolmetschende Person in die 3. Person wechseln, um sich selbst zu schützen (Orth, 2002). Dies geschieht oft automatisch und unbewusst und kann als Belastungshinweis gewertet werden. Die Dolmetscherin sollte keinen Einfluss auf den Gesprächsverlauf nehmen und keine Nebengespräche mit der Patientin führen. Sie sollte sich neutral und unparteiisch verhalten. Religiöse oder politische Einstellungen dürfen die Übersetzung nicht beeinflussen. Eigene Einschätzungen und Interpretationen sind während der Sitzung nicht erwünscht, sollten gegebenenfalls aber im Nachgespräch angesprochen werden. Damit nimmt die dolmetschende Person in dieser Hinsicht eine eher „passive“ Rolle hinsichtlich des Gesprächsverlaufes ein. Dies sollte als Arbeitshaltung verinnerlicht werden, um etwaigen Rollenkonflikten vorzubeugen.
3.4.3 Sitzordnung
Die Rollen von Dolmetscherin und Therapeutin können durch eine bestimmte Sitzordnung hervorgehoben werden (Haenel, 2001; Gondos, 1992), indem Therapeutin und Patientin sich gegenübersitzen, während die Dolmetscherin zwischen beiden sitzt, sodass ein gleichschenkliges Dreieck entsteht. Somit bilden Patientin und Therapeutin eine Hauptachse, wobei die dolmetschende Person ein Stück weit außerhalb dieser Achse positioniert ist, sich jedoch immer noch jeder Gesprächspartnerin gleich gut zuwenden kann. Keinesfalls sollen Dolmetscherinnen aus dem Blickfeld der Patientin bzw. Therapeutin verschwinden, indem sie hinter der Patientin oder Therapeutin sitzen (Morina et al., 2010; Abdallah-Steinkopff, 2000).
3.5 Nach dem Gespräch
3.5.1 Nachbesprechung
Die Nachbesprechung hat fallbezogen eine sozialisationsvermittelnde und reflexive Funktion. Zudem sollten auch Fragen von Rollenkonflikten oder der Eigenbelastung der dolmetschenden Person Raum haben. Sie gewährleistet außerdem, dass die dolmetschende Person erst nach der Patientin den Raum verlässt, was zum einen das Selbstverständnis von Therapeutin und Dolmetscherin als Team unterstreicht und zum anderen die Dolmetscherin davor bewahrt, sich gegenüber ggf. vorgebrachten Bitten der Patientin an den Dolmetscher, ihn bei weiteren Angelegenheiten zu unterstützen, abgrenzen zu müssen.
Im Nachgespräch können Schwierigkeiten sowie Eigentümlichkeiten in der Kommunikation und dem sprachlichen Ausdruck ausgetauscht werden. Es ist wichtig, im Sinne einer Verbesserung der Gesprächsgestaltung, dass sich Dolmetscherin und Therapeutin über Besonderheiten beim Gespräch austauschen. Zum Beispiel sind manche Sätze im Konjunktiv nicht ohne weiteres in jede Sprache übersetzbar und können damit fälschlicherweise als Unterstellungen oder Handlungsanweisungen verstanden werden (Kluge u. Kassim, 2006; Schepker u. Toker, 2009). Außerdem können soziokulturelle Hintergrundinformationen und Besonderheiten (wie beispielsweise Tabus) bei der dolmetschenden Person eingeholt werden. Die Angaben der Dolmetschenden können wichtige Anregungen geben, die gegebenenfalls im Folgegespräch mit der Patientin verifiziert oder falsifiziert werden können. Generell sollten Therapeutinnen auch innerhalb einer Sitzung subjektiv soziokulturelle Vorstellungen und Unsicherheiten offen ansprechen, um sich die subjektive Sicht der Patientinnen und ihrer Bezugspersonen schildern zu lassen. Die Einschätzung der Dolmetscherin sollte hier von massiven Missverständnissen ausgenommen erst im Nachgespräch erfolgen. Die potenzielle Belastung einer Dolmetscherin und die therapeutische Verantwortung, auch für ihre Psychohygiene, wird am Gesprächsanfang benannt. In der Regel wird dies von Patientinnen als Achtsamkeit gegenüber Belastungen wahrgenommen. Sollten sich Dolmetscherinnen durch Inhalte innerhalb der therapeutischen Zusammenarbeit belastet bzw. überfordert fühlen, sollte dies im Nachgespräch ebenfalls mitgeteilt werden. Die emotionale Belastung für Dolmetscherinnen in schwierigen Therapiesituationen sollte nicht unterschätzt werden (Jacobson & Vesti, 1990). Es ist die Aufgabe der Therapeutin die Dolmetscherin, danach zu fragen und die Rückmeldung über eine gegebenenfalls bestehende psychische Belastung als hochgradig professionelle und damit explizit gewünschte Art der Zusammenarbeit zu vermitteln. Es sollte dann gemeinsam nach Wegen gesucht werden, um die psychische Belastung der Dolmetscherin zu mindern und emotionale Regulationsstrategien zu vermitteln. Sollte dies im Einzelfall nicht ausreichend sein, sollte zum Schutz der Dolmetscherin ein Wechsel überlegt werden oder ggf. eine Vermittlung zu einem Unterstützungsangebot erfolgen.
4. Dolmetscherinnenschulungen und Supervision
Zum Zwecke der Qualitätssicherung sollten Schulungen für Dolmetscherinnen angeboten werden, in denen allgemeine Prinzipien des Dolmetschens in therapeutischen Kontext vermittelt und aktiv eingeübt werden. Schulungen sollten mit Fortbildungszertifikaten (i.S.v.: „Dolmetschen in Beratung und Psychotherapie“) honoriert werden. Die klinische Praxis zeigt, dass Dolmetschende teilweise mit hochbelastenden Krisensituation und Gesprächsinhalten im Rahmen ihrer Einsätze konfrontiert werden. Es sollten daher regelmäßige Supervisionen für Dolmetscherinnen angeboten werden, um einen geschützten Raum zu schaffen, in dem sich diese über die jeweiligen Prozesse und zum Thema Psychohygiene Unterstützung holen bzw. geben können.
Fazit für die Praxis
Wie auch in der klassischen Dyade zwischen Therapeutin und Patientin gilt auch in der Triade zwischen Therapeutin, Patientin und Dolmetscherin, dass Kommunikation und Beziehung untrennbar miteinander verknüpft sind. Hohe Transparenz, Klarheit über Regeln und Geduld auf allen Seiten sind die Basis für ein respektvolles, offenes und vertrauensvolles Miteinander und das Gelingen therapeutischer Arbeit. Dolmetscherinnen sind spezifisch für den Einsatz im therapeutischen Setting zu schulen und eine Kontinuität in der Zusammenarbeit ist herzustellen. Somit sollte eine Dolmetscherin idealerweise den gesamten diagnostischen und therapeutischen Prozess einer Patientin begleiten, um eine tragfähige und verlässliche Beziehungsgestaltung möglich zu machen. Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Therapeutin und Dolmetscherin sind Vor- und Nachgespräche jeder Sitzung essenziell. Unter anderem durch ihre sozialisationsvermittelnde und reflexive Funktion tragen sie zur Qualitätssicherung entscheidend bei. Außerdem können sie die Entstehung psychischer Belastungssymptome bei der Dolmetscherin frühzeitig erkennen oder vorbeugen helfen, indem Belastungen, welche Beispielsweise vor dem Hintergrund eigener biografischer Erfahrungen mit Flucht und Migration während therapeutischer Sitzungen getriggert werden können, direkt kanalisiert werden. Darüber hinaus sollten jedoch auch regelmäßig Supervisionstermine angeboten werden. In der psychotherapeutischen Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen ist professionelle Dolmetschung eine notwendige Qualitätsleistung, der durch Bereitstellung zusätzlicher personeller und zeitlicher Ressourcen (Dolmetscherin, Therapeutin, Sekretariat etc.) Rechnung getragen werden muss.