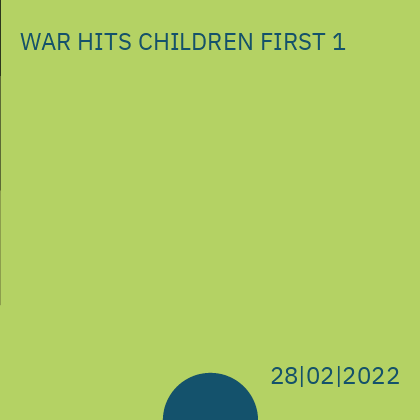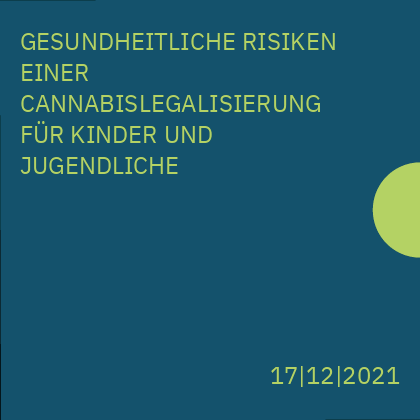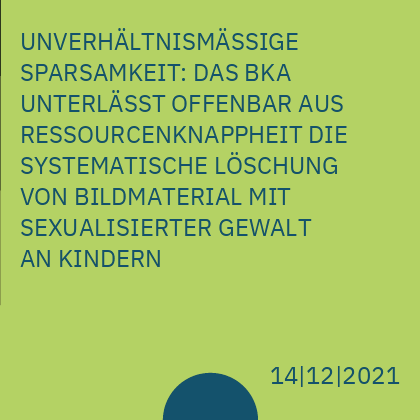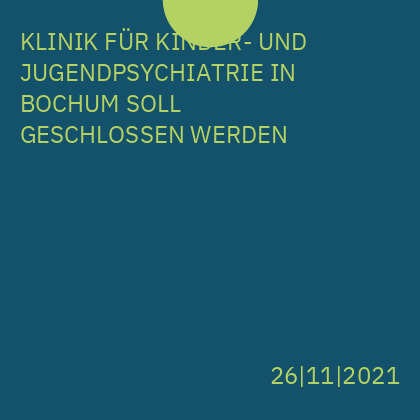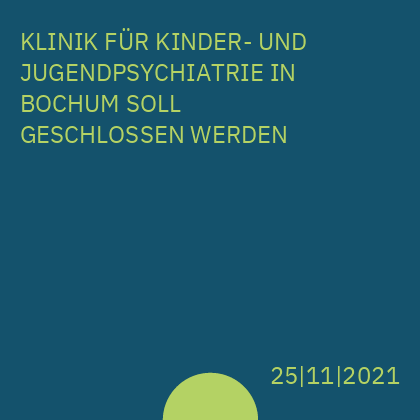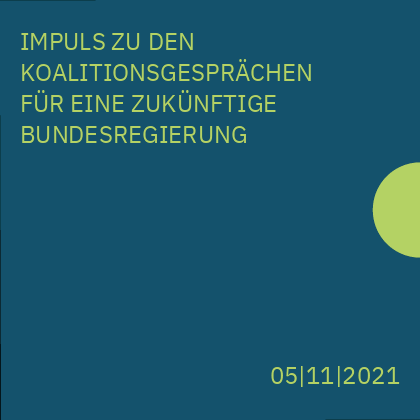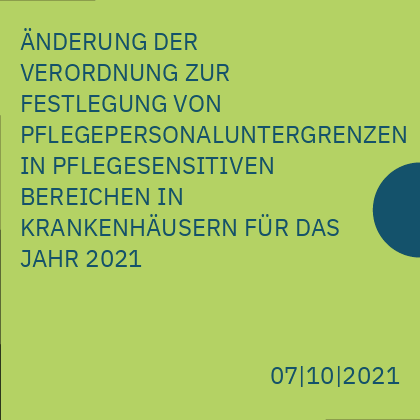Stellungnahme der DGKJP zum „Gemeinsamen Bericht über die Auswirkungen der stationsäquivalenten psychiatrischen Behandlung im häuslichen Umfeld auf die Versorgung der Patientinnen und Patienten einschließlich der finanziellen Auswirkungen gemäß § 115d Absatz 4 SGBV“
Isabel Boege, Renate Schepker, Tobias Renner, Michael Kölch und Vorstand der DGKJP
Laut § 115 d SGB V wurden die Selbstverwaltungspartner Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und GKV-Spitzenverband (GKV) sowie der Verband der Privaten Krankenversicherungen (PKV) verpflichtet, dem Bundesgesundheitsministerium zum 31.12.2021 einen Bericht zu den Auswirkungen der Einführung der neuen Art der Krankenhausversorgung durch stationsäquivalente Behandlung (StäB) vorzulegen. Dieser Bericht wurde nun veröffentlicht.
Er enthält am Schluss eine positive Bewertung seitens der DKG und Kritik bzgl. „Übervergütung“ und „Unterversorgung“ seitens der GKV, sowie deren Forderung, StäB zugunsten einer intensiven PIA-Behandlung in allen Regelungen zu streichen. Sowohl Methodik als auch Schlussfolgerungen können aus Sicht der wissenschaftlichen Fachgesellschaft der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie nicht unwidersprochen bleiben. Ein Bericht mit eklatanten methodischen Mängeln und unbestätigten Vorannahmen – etwa hinsichtlich des Anteils an Pflegepersonal an den je Patient:in aufgewendeten Stunden im vollstationären Bereich – so wie fehlender Rezeption bisheriger Forschungsergebnisse sollte keine Handlungsgrundlage für die Politik werden.
Die Methodik und der Datenbezug des Berichts sind insuffizient
Die Analyse beruht auf Auswertungen des InEK über die Daten des Datenfiles nach § 21 KHEntgG sowie die abgerechneten PEPPs (QK80Z für die KJPP) bzw. hinterlegten OPS-Kodes. Bei der Anzahl der StäB-Krankenhäuser (S.6) wird in Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie nicht differenziert, ebenso wenig bei der StäB-Landkarte (S.7) so dass eine Grundgesamtheit für unser Fachgebiet nicht korrekt auszumachen ist. Dieser Mangel zieht sich durch die Berichtslegung durch.
Wenn etwa der Anteil an StäB-Patienten mit dem Gesamtvolumen der großen Erwachsenenpsychiatrie abgeglichen wird (unfairerweise einschließlich der von den meisten Einrichtungen laut Diagnosestatistik ausgegrenzten Suchtpatienten, die immerhin rund 1/3 der stationären Belegung in Erwachsenenpsychiatrien ausmachen) belaufen sich die StäB Fälle auf 0,3% der Behandlungsfälle/Jahr. Verglichen mit allein einer uns bekannten Einrichtung der KJPP verzerrt das die Daten horrende – hier waren die StäB-Patienten 2018: 4,7%, 2019: 10,03%, und 2020 15,02% aller Fälle.
Auch das Berechnen der StäB Patienten auf die Gesamtheit aller Patienten würde sich durch „Herausrechnen“ kinder- und jugendpsychiatrischer Pioniereinrichtungen stark reduzieren: für den EP Bereich ist ein Verhältnis von 1:324 im Jahr 2020 beschrieben, in einer modellhaften KJPP beträgt es 1:5,64. Das wird im Bericht aus Datenschutzgründen nicht angegeben, obwohl das InEK den Selbstverwaltungspartnern auch (anonymisierte) Daten einzelner Einrichtungen zur Verfügung gestellt hat und die Spannbreite des „Ausrollens“ der StäB Behandlung in der Fläche nur daran gut aufgezeigt werden kann.
Des Weiteren enthält der Bericht keine Ergebnismaße, wie etwa Patientenzufriedenheitsbewertungen, Einschätzungen der Funktionsfähigkeit, Stabilität des Behandlunsgerfolgs über die Zeit oder der noch vorhandenen Symptomschwere bei Entlassung, sondern es werden ausschließlich Leistungen aus den Routinedaten betrachtet. Schlussfolgerungen, welche Patienten nun besonders vom StäB Angebot profitieren sind damit obsolet. Die 60 % Fälle, die eine weitere psychiatrische Krankenhausbehandlung erhalten haben werden weder nach institutsambulant, voll- oder teilstationär differenziert noch nach Erwachsenen oder Kindern und Jugendlichen – selbstverständlich sollte eine StäB-Behandlung ja kurz gehalten werden und eine ambulante Nachbehandlung, idealiter in personeller Kontinuität, zur Stabilisierung angeschlossen werden.
Innerhalb der erhobenen Daten ist ein Vergleich von StäB z.B. mit der vollstationären Behandlung nicht erfolgt – aufgrund der unterschiedlichen Struktur der jeweiligen OPS wäre ein solcher auch nicht hinsichtlich der Leistungen möglich gewesen, aber sehr wohl hinsichtlich der Diagnosen oder der Altersstruktur.
Die kursorisch geschilderten Mängel, die gegenüber der GKV durch den Medizinischen Dienst benannt werden seien, werden im Bericht weder mit Daten belegt noch werden KJPP und EP unterschieden -sie sind deswegen nicht verwertbar.
StäB eignet sich für alle Patient:innengruppen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
Die Diagnoseverteilung entspricht dem üblichen stationären kinder- und jugendpsychiatrischen Spektrum mit vielen F9-Diagnosen und depressiven Störungen, die sich in der Priorisierung der drei untersuchten Jahre abwechseln. Das wird später nicht diskutiert, sondern im Gegenteil seitens der GKV behauptet, StäB eigne sich „nur für eine sehr kleine Patientengruppe“ (S.38).
Die Schlussfolgerung der GKV, „Die meisten krankenhausbehandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten mit einer psychiatrischen Erkrankung profitieren stärker von einer vollstationären Versorgung“ (S.38) ist bereits methodisch nicht zulässig, da nicht mit Daten begründet (s.o.). Die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie erhobenen und publizierten Ergebnisse (auf Wunsch gerne von der DGKJP-Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt) belegten eine Gleichwertigkeit der Behandlungsergebnisse und der Symptombelastung mittels Health of the Nation Outcome Scale for Children and Adolescents (HONOSCA), Children global assessment Scale (CGAS), welcher der Achse 6 der MAS in der KJPP entspricht und somit ein relevantes Maß für die psychosoziale Funktionsfähigkeit darstellt, das sich bei allen Patienten deutlich analog einer stationären Behandlung verbesserte und eine Gleichwertigkeit hinsichtlich der Patientenzufriedenheit, welcher auf Elternseite eher noch zugunsten von StäB ausfiel. Die erhaltene Therapie wurde im Vergleich zur vollstationären Behandlung von den Patienten und Eltern als intensiver und zielführender gewertet, da immer ein sehr individuelles Eingehen auf die Patient:innen unter Einbezug des Elternhauses und der Schule stattfindet. Für Familien mit Kindern ist das ein zentrales Behandlungselement. Eltern benannten zu fast 75,6%, dass sie einen eigenen Kompetenzgewinn zu verzeichnen hatten, und somit mit Problematiken zu Hause besser umgehen konnten, die Patient:innen erreichen gut 83,3%. Stationäre Patienten zeigten vergleichbare Werte (73,3%), Eltern von stationären Patienten benannten hingegen nur einen Kompetenzgewinn von 25,7%, was langfristi.g deutlich weniger Stabilität bedeutete und zu Wiederaufnahmen führte.
StäB arbeitet sehr wohl multiprofessionell und mit hohem Aufwand
Aufgezählt und immerhin breit dargestellt wird, dass in der KJPP mit durchgängig mehr Psychologen und Spezialtherapeuten gearbeitet wird. In 55 % (2018) bzw. 75 % (2020) der Fälle waren regelhaft 4 Berufsgruppen in die Behandlung einbezogen. Die Kritik der mangelnden Multiprofessionalität trifft somit die KJPP nicht – in der Erwachsenenpsychiatrie liegen die Anteile des Einbezugs von 4 Berufsgruppen deutlich geringer mit 24-51%. Auch hier wurde nach den vorgelegten Zahlen der Beweis erbracht, dass in der KJPP StäB der vollstationären Behandlung ebenbürtig ist.
Ebenfalls zu wenig gewürdigt wird, dass die KJPP-StäB-Teams hohe Minutenzeiten in den Familien verbracht haben gegenüber vergleichsweise den erwachsenenpsychiatrischen Teams (EP) und dass hier eine gegenläufige Entwicklung zu verzeichnen ist. 2018 zählte die KJPP 2269min vs. EP 1462min, 2019 KJPP 1981min vs. EP: 1824min; 2020 KJPP 2371min vs. EP 2045min. Die StäB-Teams der KJPP bewerten den Abfall der Minutenwerte innerhalb der Familien (2018 87min, 2019 72min, 2020 62min) als einen Ausdruck der Professionalisierung (es hat eine Verschiebung in die Außenkontakte, wie Schulen, von den Familien aus stattgefunden im Sinne der Bedarfe der Kinder). Auch das wird nicht diskutiert. Die Verteilung der geleisteten Minuten zwischen dem Pflege- und Erziehungsdienst (PED) (ca 44-59%) und dem Ärztlichen Dienst (ca 30%) entspricht in der KJPP den auch in der PPP-Richtlinie festgelegten Verhältnis zwischen den Berufsgruppen, sogar mit einem damit verglichen eher hohen Arzt-Minutenanteil, anders als die GKV im Schlussstatement glauben macht.
Die Schlussfolgerung der GKV „Damit bleibt die Versorgung im Rahmen einer StäB, insbesondere hinsichtlich der Intensität sowie der Multiprofessionalität, weit hinter einer vollstationären Behandlung zurück“ (S. 38) ist ebenfalls nicht belegt. Hier hätte ein Vergleich mit vollstationärer 1:1-Betreuung durch den Pflege- und Erziehungsdienst erfolgen müssen, der bekanntlich basierend auf Realkostenkalkulationen des InEK im vollstationären Rahmen bereits ab einer Stunde täglich in der KJPP ein „erhöhendes Tagesentgelt“ generiert. Auch wären für einen Vergleich von erfolgten Einzeltherapiestunden Daten für die Berufsgruppen der Ärzt:innen, Psycholog:innen und Spezialtherapeut:innen aus den OPS generierbar gewesen.
Die implizit vorgetragene Abwertung der Tätigkeiten des Pflege- und Erziehungsdienstes: „Zugleich zeigen die Daten aber auch, dass der Hauptanteil der Leistungen durch Pflegefachpersonen erbracht wurde, auf diese Berufsgruppe entfallen über die Hälfte aller OPS-Kodes“ (S. 38), ist fachlich nicht haltbar. Zunächst kann bereits für den vollstationären Bereich aus den Minutenwerten der PPP-RL je Patient abgeleitet werden, dass die PED-Minutenwerte die der anderen Berufsgruppen um ein Vielfaches überschreiten (in der Kategorie KJ1 i.V. zu Ärzt:innen 7,5:1; i.V. zu Psychotherapeut:innen 10:1, i.V. zu Fachtherapeut:innen und Sozialarbeiter:innen 4,7:1). Auch inhaltlich ist das sinnvoll – der PED ist essentiell in der Behandlung von Kindern und Jugendlichen, in der es sehr viel um Pädagogik/Alltagstransfer von Therapie und auch um Elternberatung/training geht.
StäB ist in der KJPP unter- und nicht überfinanziert
Bezüglich der Wirtschaftlichkeit ist nicht von einer „Übervergütung“ sondern vielmehr hinsichtlich der KJPP von einer Unterbezahlung auszugehen. In den erhobenen Minutenwerten spiegeln sich nicht die nötige Netzwerkarbeit wieder, die parallel von der Klinik aus erfolgt, Fortbildungs- und Dokumentationszeit des Teams, Aufwände für die Organisation oder Ausfallzeiten. Bei einer nur auf den Patientenaufwand bezogenen Berechnung muss die Fahrzeit mit einbezogen werden, die Multiprofessionelle Fallbesprechung, nötige strukturelle Organisationszeiten (wer fährt wann wohin?) sowie Übergabezeiten (Kommunikation zum Übereinanderlegen der jeweiligen Therapieeinheiten ist essentiell für den Erfolg von StäB), so dass – auch wenn es nur 62min vor Ort sind – leicht das doppelte bis dreifache an aufgewendeter Zeit resultiert. Somit muss pro Patient ein deutlich größeres Zeitvolumen angesetzt werden, was eine entsprechende Personaldecke voraussetzt. Da in StäB eher erfahrenere Kräfte mit Zusatzweiterbildung arbeiten, deren Gehälter höher sind als der Klinikdurchschnitt, damit das hochqualitative Angebot geleistet werden kann, muss sich dies in der Vergütung abbilden. Dadurch, dass in der KJPP jedes Krankheitsbild in jeglicher Schwere behandelt werden kann, ist ein Wirtschaftlichkeitsgebot im Vergleich zu einer stationären Behandlung für das gleiche Störungsbild mit ca 350-500€ versus aktuell durchschnittlich 245€ in StäB (im Bericht angegebene Erlöse 2018: 189,68€, 2019: 245,14€, 2020: 251,25€) auf jeden Fall gegeben – derzeit sind kinder- und jugendpsychiatrische Leistungen in StäB stark unterfinanziert.
Der Medizinische Dienst hat laut GKV 553 StäB-Fälle im Zeitraum vom 4. Quartal 2019 bis 1. Quartal 2021 begutachtet und ausgewertet. „Das wohl eindringlichste Ergebnis dieser Auswertung war, dass 20 % der begutachteten Fälle keine Krankenhausbehandlungsbedürftigkeit aufwiesen […].Die Analyse zeigte zudem, dass weitere wichtige Qualitätsanforderungen wie beispielsweise die vorgeschriebenen täglichen direkten Patientenkontakte oder die wöchentlichen ärztlichen Visiten nicht immer realisiert wurden“ (S. 39). Aus Sicht der Kinder- und Jugendpsychiatrie dürfte es sich hier nur um wenige Einzelfälle handeln. Eine bestätigte primäre Fehlbelegung aus unserem Fach ist uns nicht bekannt – allenfalls erfolgten bei überlastetem Familiensystem doch einzelne vollstationäre Aufnahmen. Tägliche Patientenkontakte sind als Essenz der StäB Behandlung selbstverständlich einzuhalten, strittig war z.B. lediglich die – für 2022 durch einen Zusatz im OPS geheilte – Frage, ob ein Elterngespräch mit nur kurzer Begrüßung des Kindes auch als „Patientenkontakt“ gelte.
In StäB fehlt bisher die Erweiterung auf andere ambulante Leistungserbringer
Eine lapidare Nebenbemerkung der GKV: „Ergänzend weisen auch Leistungserbringer […] selbst auf eine unzureichende Einbindung ambulanter Leistungserbringer zur Herstellung der gewünschten Behandlungskontinuität […]hin“ verdeckt, dass der Bericht der Selbstverwaltung den klaren Auftrag aus der Gesetzesbegründung nicht erfüllt hat, der sogar noch weiter ging: „Aufgrund dieses Berichts kann die Entscheidung getroffen werden, ob und in welcher Form z. B. Netzwerke ambulanter Leistungserbringer die StäB selbstständig, das heißt nicht nur im Wege der Beauftragung, durchführen können“ (BT-Drucksache 18/9528, S. 49). Die Selbstverwaltung hätte hier einräumen müssen, dass sie selbst zur Unmöglichkeit der Übernahme von StäB-Leistungen durch andere ambulante Leistungserbringer, wie etwa sozialpsychiatrische Praxen beigetragen hat, indem sie nämlich in der Rahmenvereinbarung den möglichen Umfang auf 50% der Leistungen je Fall begrenzt hat.
StäB hat sich als familienfreundliche Behandlungsart bewährt
Somit ist es insgesamt keineswegs zutreffend, dass StäB in der KJPP „den gesetzlich vorgegebenen Anspruch der Krankenhausbehandlung im häuslichen Umfeld [verfehlt]“ (S. 38). Es sei darauf verwiesen dass in der politischen Diskussion StäB insbesondere als familienfreundliche und familiennahe Behandlungsform beschlossen wurde; auch vor dem Hintergrund, Einsparungen bei der besonders aufwändigen Kinder- und Jugendpsychiatrie vornehmen zu können (Stichwort: Aufbau (von StäB) statt Ausbau (von Betten)). Schlussfolgerungen, welche die StäB-Einheiten der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit denen der Erwachsenenpsychiatrie über einen Kamm scheren, undifferenziert sind und welche existierende Forschungsergebnisse nicht in den Blick nehmen, können nur als unseriös und eines Evaluationsberichts nicht würdig bezeichnet werden. Auf die wirklich existierende Problematik der Unmöglichkeit, dass in den großen Versorgungsgebieten der KJPP ohne Einbezug anderer ambulanter Leistungserbringer viele Familien nicht erreicht werden können, geht der Bericht entgegen den Erwartungen des Gesetzgebers nicht ein.
Weiterführende Literatur entnehmen Sie bitte dem PDF.